11.11. - Faschingsbeginn und die Umstülpung der Ordnung
- 10. Nov. 2025
- 4 Min. Lesezeit
Am 11.11. ist Faschingsbeginn.
Im Grunde ist auch der Fasching ein naturmagischer Ritus, dessen Anfänge sich – wie bei so vielen Bräuchen – im Dunkel der Geschichte verlieren. Die frühen, vorchristlichen Kulturen Europas verehrten in ihrer Mythologie die zyklischen Kräfte der Natur, die schützenden Ahnen und eine göttliche Ahnfrau, aus deren heiligem Schoß alles, auch die Menschen, Tiere und Pflanzen, entsprungen war. Dementsprechend galt alles als miteinander verwandt.
In einer solchen Mythologie findet im Jahreslauf jetzt eine Art Umkehrung oder Umstülpung der Ordnung statt. Das Licht, die wärmende Sonne, ziehen sich immer weiter zurück; die Tage bleiben kalt und werden immer kürzer, die dunklen, bereits frostigen Nächte hingegen immer länger. Auch die Lebenskraft der Vegetation vergeht unaufhaltsam. Die leblose, kalte und dunkle Zeit hat nun die Oberhand. Die warme, helle, obere, sichtbare Welt und die kalte, dunkle, untere, unsichtbare Welt tauschen die Plätze. Die Menschen ziehen sich in ihre Behausungen zurück, und die Ahnen kehren nun für eine bestimmte Zeit aus der Anderswelt zurück. Von dieser mythologischen Vorstellung der Menschen zeugt heute noch der Faschingsbeginn am 11.11.
Masken und Ahnenwesen

Das Maskieren steht für die Verwandlung in ein Ahnenwesen aus der Sippengemeinschaft. Denn im Sinne der Ahnenmythologie eines zyklischen Weltbildes besuchen um diese Zeit die Ahnen als Wintergeister aus der Anderswelt die Hausgemeinschaften und Nachfahren und bringen Gaben, Glück und Segen für die Reise durch die dunkle Zeit – den Winter. Die Ahnenwesen tragen häufig die Lebensrute (Weidenzweig) mit sich, ein Symbol für die baldige Wiederkehr der Toten, die durch die Kraft der Erneuerung wieder in ihre Sippen hineingeboren werden. Die Lebenden und die Toten bilden eine Gemeinschaft und unterstützen sich gegenseitig in ihrem Schicksal. Die Maskierten symbolisieren den Totenzug bzw. die Jenseitigen, die den Menschen im Diesseits in dieser Zeit begegnen.
Hier erkennen wir auch einen weiteren Aspekt des vorchristlichen europäischen Weltbildes: die Polarität. Diesseits und Jenseits sind nicht getrennt, sondern zwei Aspekte des untrennbaren Ganzen. Leben und Tod sind jeweils zwei untrennbare Aspekte des Seins, die sich gegenseitig bedingen und ergänzen. Die zyklischen Kräfte, die die Natur gestalten, drehen sich unaufhaltsam durch die verschiedenen Pole des Seins: vom Hellen ins Dunkle und wieder zurück ins Helle, vom Tod ins Leben und wieder in den Tod.
Martinslegende - Totenzug und Jenseitsreise

Vom Durchdringen der diesseitigen und jenseitigen Welten erzählen uns viele Bräuche und Legenden – so auch sehr bildhaft die christliche Legende vom Heiligen Martin. Wir kennen die Martinslegende vom Mantelwunder: An einem eiskalten Winterabend begegnete Martin am Stadttor von Amiens einem spärlich bekleideten Bettler, der ihn um eine Gabe anflehte. Da Martin weder Essen noch Geld bei sich hatte, zog er sein Schwert, teilte seinen weiten Offiziersmantel in zwei Hälften und gab dem Bettler die eine Hälfte, damit dieser sich vor der Kälte schützen konnte.
In der folgenden Nacht erschien Martin Jesus im Traum – bekleidet mit der Hälfte des Mantels. Martin hörte, wie Christus den Engeln sagte: „Martinus, der noch auf dem Weg zur Taufe ist, hat mich mit diesem Mantel bekleidet.“ Damit wollte Jesus zeigen: Was du einem meiner geringsten Brüder tust, das tust du mir.
Auch der Martinsumzug der Kinder im Kindergarten ist uns vertraut. Die Kinder basteln farbenfrohe Laternen und ziehen, sobald es dunkel wird, in einer Reihe durch den Kindergarten oder rund um Haus und Hof. Dabei singen sie das Martinslied – von dem es viele verschiedene Versionen gibt:
„Ich geh mit meiner Laterneund meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne, hier unten da leuchten wir. ..... Mein Licht geht aus,ich geh nach Haus, rabimmel, rabammel, rabumm.“
Der Mantel, den Martin in der Legende mit seinem Schwert teilt, steht symbolisch für den jetzt sehr dünn gewordenen Schleier, der die Welten trennt und gleichzeitig verbindet. Der Schleier wird geöffnet, und die Welten dürfen sich begegnen.
Der Zug der kleinen Kinder, die zum Martinslied mit ihren Laternen durch die Nacht ziehen, steht symbolisch für den Totenzug jener Seelen, die über das Jahr verstorben sind und nun durch den geöffneten Schleier in die Jenseitswelten hinüberziehen können: „Mein Licht geht aus, ich geh nach Haus.“ Deutlicher kann Tod und Übergang kaum beschrieben werden. Dort erwartet sie die große Ahnfrau, die „Tod-im-Leben-Göttin“, die mit ihrer Wandlungskraft alles transformiert. Auch die Seelen werden von ihr verjüngt, um zu gegebener Zeit wieder in die Sippengemeinschaft hineingeboren zu werden.
In der ersten Strophe werden den leuchtenden Laternen die leuchtenden Sterne gegenübergestellt. Auch diese Sterne stehen für die Seelen, die bereits in der jenseitigen Welt angekommen sind und dort leuchten.

Der Heilige Martin übernimmt im Christentum die Rolle des Seelenführers von der vorchristlichen „Wilden Jagd“, in der die als brausender Herbststurm kreischend übers Land ziehende Tod-im-Leben-Göttin die Seelen der über das Jahr Verstorbenen einsammelte.
Die Martinigans – Nahrung für die Seelenreise
Auch das traditionelle Martinigansl hängt mit dem Übergang der Seelen in die Ahnenräume zusammen. Die Gans ist eine fette, nahrhafte Speise. Die Menschen verspeisen die Gans symbolisch für die Seelen der Verstorbenen, um diesen – im übertragenen Sinn – genügend Proviant auf ihre lange Reise in die jenseitigen Reiche mitzugeben.







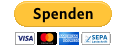
Kommentare